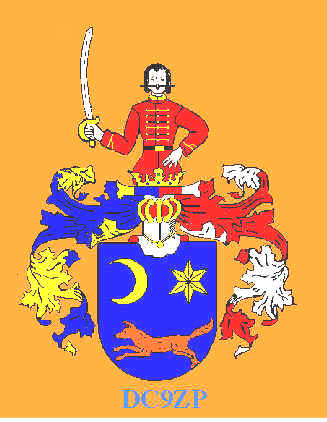 Betriebstechnik über
Satellit
Betriebstechnik über
Satellit
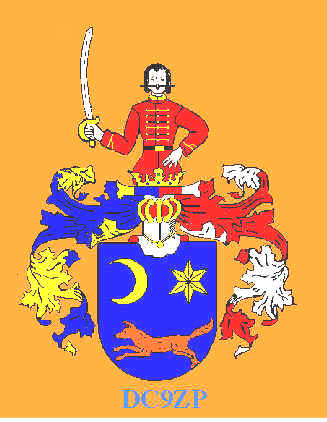 Betriebstechnik über
Satellit
Betriebstechnik über
Satellit
© DC9ZP 2005-2009
Inhaltsverzeichnis
1. Reichweite und Aussichtsweite
Die Frage, welche Länder man vom eigenen QTH - zu einer bestimmten Uhrzeit - über einen bestimmten Satelliten erreichen kann, sollte in der Regel vom Satellitenprogramm beantwortet werden. Dazu sollte der Hörbarkeitsbereich des Satelliten in Echtzeit auf einer Weltkarte grafisch dargestellt werden, damit man im Betrieb auf einen Blick sehen kann,
|
wo sich der Subsatellitenpunkt befindet, |
|
|
welcher Teil der Erde vom Satelliten aus "gesehen" wird, |
|
|
wohin sich der Satellit auf seiner Bahn bewegt, |
|
|
in welchem Modus er sich befindet, |
|
|
welche Elevation er vom eigenen QTH aus gesehen hat, |
|
|
und in welche Richtung man die Antenne drehen muss. |
Alle Länder, die innerhalb des Aussichtskreises des vom QTH aus "sichtbaren" Satelliten liegen, kann man auch vom eigenen Standort aus erreichen. Die Aussichtsweite eines Satelliten ist abhängig von seiner Flughöhe; wer den Aussichtsradius selbst berechnen will kann die im Abschnitt Bahnberechnung vorgestellten Formeln benutzen. Hinweise auf die geometrischen Zusammenhänge gibt die nachfolgende Abbildung.

2. DX-QSOs
Als DX-Verbindungen bezeichnet man im internationalen Funkverkehr Kontakte mit Stationen, die außerhalb des eigenen Kontinents beheimatet sind. Wer also als DL-Station "CQ DX Satellite" ruft, ist an Verbindungen innerhalb von Europa nicht interessiert. Leider ist diese Regel nicht mehr Allgemeingut, so dass man damit rechnen muss auch von europäischen Stationen angerufen zu werden. In diesem Fall bleibt man höflich und nimmt den Anruf an, denn der OM weiß es entweder nicht besser oder er hat den CQ-Ruf nicht richtig verstanden. Im übrigen ist ein Anruf immer besser, als reines Transponderrauschen.
Allerdings ist die Grundlage für das Zustandekommen von DX-Verbindungen nicht der CQ-Ruf, sondern zunächst das Hören. Seltene Stationen kommen meist nicht auf einen CQ-Ruf zurück, man muss sie im Transponderbereich suchen und dann anrufen. Dazu sollte man in der Lage sein auch sehr leise Signale noch aufzunehmen. Wer beim Mithören in einem laufenden QSO die DX-Station nur bruchstückhaft aufnehmen kann, weder Namen, QTH bzw. Rufzeichen vollständig mitbekommt, der sollte diese Station auch nicht anrufen.
Leider hört man immer wieder das Gegenteil, da wird minutenlang buchstabiert, zurückgefragt oder wiederholt obwohl die DX-Station mit einem gut lesbaren Signal aufwartet. Das ist unfair und rücksichtslos gegenüber den wartenden OMs, die sich mit ihrer Empfangsanlage mehr Mühe gegeben haben.
Es ist auch unsinnig, in solchen Fällen bei jedem QSO nach Namen, QTH, Postbox usw. zu fragen, da man diese Informationen aus einem der vorherigen QSOs hätte entnehmen können.
Als Fazit gilt: wer zu wenig hört, oder nicht zuhört, wird bei DX-Verbindungen trotz monströser Endstufe nur wenig Erfolg haben.
Mit Rücksicht auf wartende OM sollte man sich bei seltenen Stationen im QSO kurz fassen und nur die notwendigsten Informationen austauschen. Einzelheiten wie Konfiguration der Antennen, Design der Endstufe etc. sollte man lieber später auf die QSL-Karte schreiben. Im Unterschied zur Kurzwelle gibt es auf den Satelliten so gut wie keinen "Split Frequency" Betrieb durch DX-Stationen, d.h. die Station hört und sendet auf der gleichen QRG. Ausnahmen bestätigen aber die Regel und wer lange genug zuhört, wird auch dies leicht herausfinden.
Beim Anruf sollte man darauf achten, sich selbst auf die richtige QRG zu lotsen. Da man sich über den Satelliten selbst zurückhört, ist dies eine leichte Übung. Trotzdem haben einige Stationen damit Schwierigkeiten, sie liegen immer neben der QRG, ärgerlich ist das insbesondere bei größeren Runden, man ist dann bei jeder Station mit dem Nachziehen des RX (RIT) beschäftigt. Ein gewisser Frequenzversatz zwischen einzelnen, weit entfernten Stationen ist allerdings normal, da der Satellit in verschiedenen QTH auch einen verschieden hohen Dopplereffekt bewirkt.
3. QSL-AustauschInsgesamt ist die QSL-Moral nicht schlecht, sie ist zumindest erheblich besser als bei KW-DX, aber auch auf den Satelliten gilt, dass man die QSL-Karte für eine seltene Station am besten auf dem direkten Weg erhält. Dazu schickt man der DX-Station neben der QSL-Karte auch noch einen an sich selbst adressierten Rückumschlag ( SASE ) sowie als Ausgleich für die Portokosten mindestens 2 IRC oder besser 2 Dollar. Wer viel DX macht und z.B. das DXCC erwerben will, dem empfehle ich das "Internationale Callbook" entweder als Buch oder als CD-ROM zu beschaffen, um bei Bedarf die Anschriften der DX-Stationen herauszufinden.
Dass man QSL-Karten vollständig ausfüllt und unterschreibt, möchte ich deshalb unterstreichen, weil mittlerweile diese banale Regel nicht mehr überall beachtet wird. Bei Satellitenverbindungen hat sich eingebürgert, in der Spalte "Frequenz" die Uplink - und die Downlinkfrequenz einzutragen, der Name des Satelliten allein oder der Transpondermodus reichen hier nicht. Der Satellitenname wird zusätzlich an geeigneter Stelle auf der Karte so eingetragen, dass er nicht zu übersehen ist. Zum Beispiel "QSO via OSCAR 40" etc. Auf jeden Fall muss aus der Karte eindeutig hervorgehen, dass es sich um eine Satellitenverbindung handelt, sonst zählt sie nicht für spezielle Satellitendiplome.
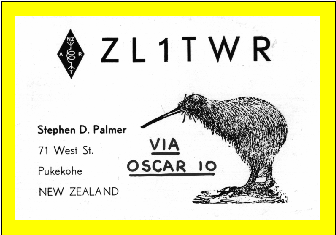

Zur abgebildeten QSL-Karte:
DX-Verbindungen zwischen DL und Neuseeland über Amateurfunksatelliten waren bisher nur über OSCAR 10 möglich, weil er aufgrund seiner niedrigen Inklination von ca. 27 Grad, den Funkbetrieb auf die Südhalbkugel favorisierte und für wahrhaft exotische Länder sorgte. Die Entfernung zwischen beiden Stationen lag bei ca. 17500 km und damit knapp unterhalb der Höchstreichweite von AO-10 mit ca. 18000 km. In beiden QTH betrug die Elevation des Satelliten ca. 1-2 Grad. Die Verbindung war 1984 über AO-10 nur für einen begrenzten Zeitraum möglich, da sich durch die Verschiebung des Argument des Perigäums [Vgl. Formel 4] das Apogäum des Satelliten so verlagerte, dass ZL später nicht mehr zu erreichen war. Über AO-13 war die Verbindung nicht machbar. Über AO-40 ist diese Verbindung am 29.08.2001 zwischen DL1RG (Nauen) und ZL1AOX (Auckland) wieder gelungen. Herzlichen Glückwunsch !!!!
4. Tipps zur Betriebstechnik in SSB
Als Neueinsteiger im Satellitenfunkverkehr empfiehlt es sich zunächst auf dem Downlinkband zuzuhören. Man lernt dabei schnell mit welcher Betriebstechnik man aufwarten muss, um zum Ziel zu kommen. Aber Vorsicht, nicht jeder OM der sich auf dem Satelliten tummelt, ist in dieser Hinsicht auch ein Vorbild. Satellitenfunkverkehr ist Vollduplexverkehr, man hört sich selbst und gleichzeitig auch die Gegenstation, trotzdem hat sich eingebürgert auch hier definierte Mikrofonübergaben zu machen und die Gegenstation nach dem eigenen Durchgang zum Senden aufzufordern. Lediglich in größeren Runden darf man auch durcheinander reden und anderen ins Wort fallen.
4.1 Der CQ-Ruf
Um zu einer SSB-Verbindung über einen Satelliten zu kommen, geht man nach Methode 1 wie folgt vor:
|
Eine freie Frequenz suchen und sein eigenes Sendesignal so einstellen, dass man sich selbst zurückhört. Hört man sich nicht, dann ist man entweder auf der falschen QRG oder der Empfangsweg ist - ausreichende Sendeleistung vorausgesetzt- zu taub. Es kann sich aber auch um einen momentanen Einbruch des Signals handeln, deshalb ist hier Geduld angebracht. |
|
|
Hört man sich einwandfrei selber, dann kann man jetzt, so wie auf jedem anderen Amateurfunkband, CQ rufen. In der Regel wird der Name des Satelliten mit angegeben, also CQ OSCAR 10 oder einfach CQ OSCAR. |
|
|
Wird man angerufen - man muss damit rechnen dass die anrufende Station neben der Frequenz liegt - dann zieht man sein eigenes Signal auf die QRG der anrufenden Station und antwortet. |
4.2 Zuhören und suchen
Die zweite Methode besteht darin zunächst das Passband des Satelliten absuchen, sich eine Station heraussuchen und sie dann anzurufen. Ein laufendes QSO unterbricht man grundsätzlich nicht, es sei denn, man kennt beide Stationen. In der Regel hört man also zu, wartet bis das QSO beendet ist und ruft dann an. Es ist aber zulässig, in Umschaltpausen - diese gibt es streng genommen bei Vollduplexverkehr aber nicht - kurz sein eigenes Call zu nennen, um zu signalisieren, dass ein Anrufer wartet. Kommt das QSO nicht zustande, dann liegt es meist daran, dass die Station nach dem QSO sofort QSY gemacht hat, weil es nicht ihre Frequenz war. Dann hat man Pech gehabt. In der Regel klappt es aber, wenn man schnell genug ist und sich mit seinem Sendesignal auf die Station abgestimmt hat. Solche Abstimmungsvorgänge muss man üben, ohne Training kommt man oft zu spät.
Wenn die Station sie informiert, dass sie auf eine andere QRG geht, dann folgen sie ihr und rufen sie auf der vereinbarten Frequenz an. Die Absprache bezieht sich immer auf die Downlinkfrequenz. "10 kHz nach oben" bedeutet, dass man 10 kHz oberhalb der ursprünglichen Empfangsfrequenz sucht. Nicht verwechseln mit der Sendefrequenz, die meist invertiert ist (AO-10, AO-40), man muss den TX dann 10 kHz tiefer einstellen.
4.3 Das eigene Echo
Bei hochfliegenden Satelliten wird man bemerken, dass man sein eigenes Signal mit einer Verzögerung zurückhört. Das ist durch die Laufzeit des Signals zum Satelliten und zurück bedingt und betrug bei AO-10 im Apogäum ca. ¼ Sekunde und bei AO-40 einige zehntel Sekunden mehr. Sie berechnet sich in Sekunden aus der nachstehenden Faustformel :

wobei die Entfernung in km einzusetzen ist.
Man muss sich erst daran gewöhnen die Signalverzögerung zu verkraften und gleichzeitig normal weiterzusprechen. Viele OM sprechen unnatürlich langsam und versuchen intuitiv die eigene Aussendung mit dem Downlinksignal zu synchronisieren. Das gelingt aber natürlich nicht. Es ist in solchen Fällen besser, die Stärke des Downlinksignals im Kopfhörer, z.B. durch einen Schalter bei Sendebetrieb, erheblich zu reduzieren. Dann stört das eigene Signal nicht mehr und man kann trotzdem noch Zwischenrufer hören.
4.4 Der Kopfhörer
Man hört öfter Stationen auf dem Transponder, die einen so großen Halleffekt haben, dass sie nicht mehr aufzunehmen sind. Ursache in diesen Fällen ist der eingeschaltete Stationslautsprecher, dessen Schall gleich wieder über die Uplinkstrecke noch oben geschickt wird und alle Zuhörer im Downlinkband mit Rückkopplung beglückt.
Es soll Funkamateure geben, die Kopfhörer nur für die Stereoanlage benutzen und nicht wissen, dass manche DX-Verbindungen nur mit dem Kopfhörer möglich sind.
Der Kopfhörer im Satellitenfunkverkehr ist daher für DX-Verbindungen unerlässlich und zwingend erforderlich, nur zu Demo-Zwecken darf man auch mal den Stationslautsprecher verwenden.
Wer keinen Kopfhörer hat, der kann sich selbst einen basteln. Dazu nimmt man die handelsüblichen Schallschutzkappen, die in jedem Baumarkt zu erstehen sind und baut in die Muscheln je eine Hörkapsel ( von der ehemaligen Post ) ein. Dazu kann man alte Telefone plündern, die Telekom prüft sie bei der Abgabe sowieso nicht. Mit dieser Anordnung und der damit verbundenen frequenzmäßigen Begrenzung auf den Sprachbereich, kann man auch noch Signale lesen, die verrauscht sind.
Die Lösung hat außerdem den Vorteil, dass man von Umweltgeräuschen (XYL, Kinder) weitgehend verschont bleibt, weil die Dämpfung nach Außen ca. 30 dB beträgt.
Bearbeitungstand dieser Seite :
13.07.10